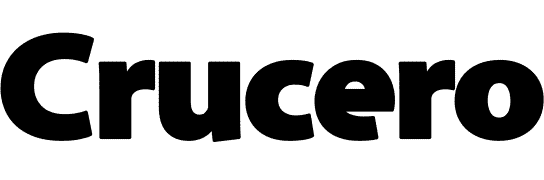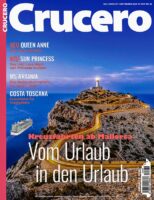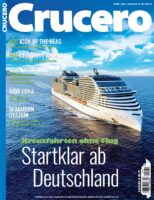Seit dem 24. Juni 2025 zeigt Netflix die Dokumentation „Trainwreck: Poop Cruise“. Sie rekonstruiert eines der bizarrsten Desaster der Kreuzfahrtgeschichte: die Havarie der Carnival Triumph.
Februar 2013, Golf von Mexiko: An Bord der Carnival Triumph kommt es infolge eines Maschinenraumbrands zu einem massiven Stromausfall. Dieser Stromausfall legt das Schiff lahm. Über 4.000 Passagiere und Crewmitglieder sind fünf Tage lang auf einem manövrierunfähigen Schiff ohne funktionierende Toiletten, Klimaanlage oder warmes Essen gefangen. Schwarze Abwässer treten in Kabinen aus, Lebensmittel verderben. Menschen schlafen in provisorischen Zelten auf dem Oberdeck. Das mediale Echo ist gewaltig. Schnell kursiert ein Begriff, der der Katastrophe ihren Spitznamen verleiht: „Poop Cruise“ – was so viel wie „Kack Kreuzfahrt“ bedeutet.
Wie rote Beutel zum Begriff „Poop Cruise“ führen
Der Ausdruck entstand in Anspielung auf die dramatisch unzureichenden sanitären Verhältnisse an Bord. Ohne funktionierendes Abwassersystem mussten Passagiere für ihre Notdurft auf improvisierte Lösungen zurückgreifen.
Besonders das sogenannte „große Geschäft“ wurde zum Symbol der Zustände. Die Crew verteilte rote Plastiktüten, die in den Kabinen verwendet werden sollten, teils in Duschkabinen oder mit Handtüchern abgeschirmten Ecken. Diese improvisierten „Toiletten“ mussten die Gäste dann selbst in mit Laken verkleideten Eimern oder Müllcontainern entsorgen. Diese standen an festgelegten Stellen auf den Gängen. Die Situation wurde noch dadurch verschärft, dass Abwässer aus Toiletten in Kabinen und Flure zurückdrangen – der üble Geruch breitete sich über das ganze Schiff aus.
Diese extrem unhygienischen Zustände wurden von Medien und Passagieren gleichermaßen aufgegriffen. Sie wurden mit dem wenig schmeichelhaften Begriff „Poop Cruise“ belegt. Eine Bezeichnung, die seither weltweit mit dem Vorfall assoziiert wird und durch die Netflix-Dokumentation nun erneut ins öffentliche Bewusstsein rückt.
Die Doku schildert den Vorfall anhand von Originalaufnahmen und Aussagen ehemaliger Passagiere und Crewmitglieder. Dabei geht es nicht nur um das menschliche Drama, sondern auch um strukturelle Mängel bei Sicherheit, Kommunikation und Notfallmanagement. Diese Mängel machten das Ausmaß der Krise erst möglich.

Folge der Katastrophe: Die „Cruise Passenger Bill of Rights“
Nur wenige Wochen nach dem Vorfall forderte Senator Charles Schumer (Demokratische Partei) die Kreuzfahrtbranche auf, freiwillig einen Rechtskatalog zu verabschieden: „Kreuzfahrtschiffe, die größtenteils außerhalb der Grenzen der US-Gesetzgebung operieren, sind zum Wilden Westen der Reisebranche geworden. Es ist an der Zeit, ihnen Einhalt zu gebieten, bevor noch jemand zu Schaden kommt“, erklärte Schumer damals, im März 2013.
Noch im selben Jahr verabschiedete der internationale Kreuzfahrtverband CLIA die sogenannte „Cruise Passenger Bill of Rights“.
Diese Charta sichert Passagieren bei Notfällen grundlegende Rechte zu. Dazu zählt etwa das Recht, ein im Hafen liegendes Schiff zu verlassen, wenn wesentliche Dienstleistungen wie Nahrung, Wasser, sanitäre Versorgung oder medizinische Betreuung nicht gewährleistet sind. Auch die Rückerstattung des Reisepreises bei schweren technischen Defekten ist in der Charta geregelt. Das Vorhandensein eines Notstromsystems bei Ausfall der Hauptgeneratoren sowie die Pflicht zur zeitnahen Information über erhebliche Änderungen der Reiseroute sind ebenfalls enthalten. Diese Rechte gelten für alle Reedereien, die der CLIA angeschlossen sind. Sie gelten also für die überwiegende Mehrheit der weltweit tätigen Kreuzfahrtanbieter.
Europäische Passagierrechte: Gesetzlich geregelt statt freiwillig
Ein direktes europäisches oder deutsches Pendant zu dieser Passagiercharta gibt es nicht. Dennoch sind Kreuzfahrtgäste in Europa durch die EU-Pauschalreiserichtlinie 2015/2302 und deren nationale Umsetzung in Deutschland umfangreich geschützt. Die Richtlinie verpflichtet Reiseveranstalter – und damit auch Kreuzfahrtanbieter – zu einer Vielzahl an Garantien. Das schließt Rückerstattung oder Ersatzleistungen bei erheblichen Mängeln ein. Dazu zählen auch die Unterstützung bei Rückbeförderung bei Reiseabbruch und auf Schadenersatz bei Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen.
Anders als bei der freiwilligen CLIA-Charta handelt es sich hier um verbindliche gesetzliche Regelungen. Diese sind verankert im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, §§ 651a ff.).
Aus „Carnival Triumph“ wird „Carnival Sunrise“ – und die fährt heute noch
Auch für die Carnival Triumph selbst hatte der Vorfall langfristige Folgen. 2019 wurde das Schiff nach einer umfassenden Modernisierung für rund 200 Millionen US-Dollar unter dem neuen Namen „Carnival Sunrise“ wieder in Dienst gestellt. Neben technischen Nachrüstungen erhielt das Schiff auch neue Restaurants, Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten. Heute ist die Carnival Sunrise im regulären Dienst von Carnival Cruise Line. Es ist hauptsächlich auf Routen in der Karibik unterwegs.
Nach dem „Poop Cruise“-Desaster haben viele Reedereien, insbesondere Mitglieder der CLIA (Cruise Lines International Association), massiv in technische Redundanzen investiert. Neue oder modernisierte Schiffe verfügen heute über mehrfach abgesicherte Generatoren. Diese können selbst bei Ausfall der Hauptenergieversorgung kritische Systeme wie Toiletten, Frischwasserversorgung und Kommunikation aufrechterhalten.
Kann sich ein solcher Vorfall wiederholen?
Der Ursprung des Stromausfalls war ein Brand im Maschinenraum der Carnival Triumph. Heute gelten strengere Vorschriften zur räumlichen Trennung wichtiger technischer Bereiche. Systeme zur frühzeitigen Erkennung von Ausfällen und schnellen Umschaltung auf Notstromkreise sind heute branchenweit Standard.
Ein Komplettausfall, bei dem tagelang weder Sanitärversorgung noch Kommunikation funktioniert, gilt technisch als weitgehend ausgeschlossen – zumindest auf großen, modernen Kreuzfahrtschiffen.
Ein Restrisiko lässt sich trotz aller Standards nicht zu 100 % ausschließen – besonders bei älteren oder kleineren Schiffen. Naturereignisse oder unvorhersehbare Kettenreaktionen können auch moderne Technik aushebeln – etwa bei Kollisionen, Stromausfällen im Hafen oder extremen Wetterlagen. In abgelegenen Regionen (z. B. Amazonas oder abgelegene Pazifikinseln) kann auch heute eine Evakuierung oder Reparatur tagelang dauern.